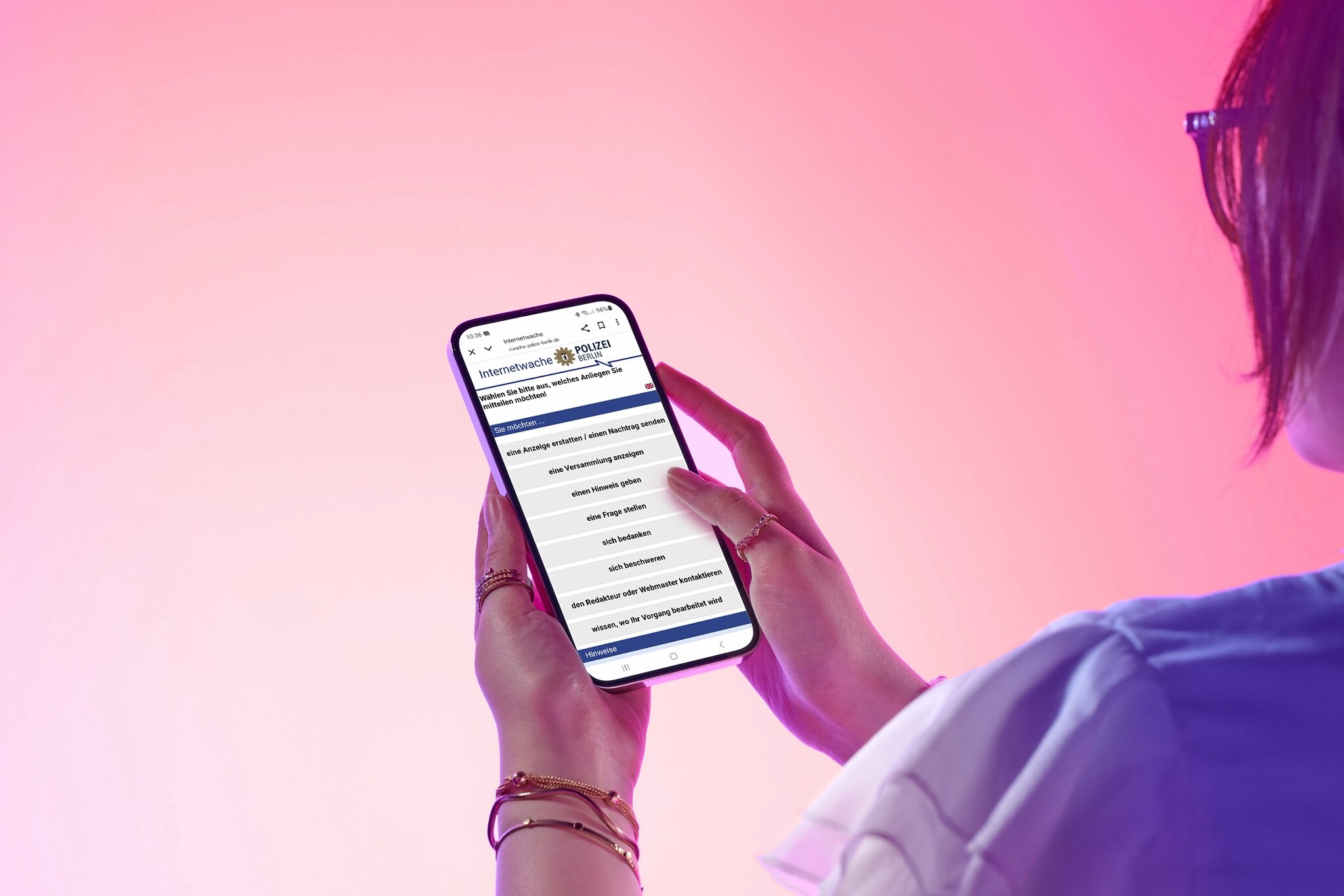
Wachsamkeit. Wer Missbrauch einer Vollmacht beobachtet, sollte dies der Polizei vor Ort melden, oder auf der Internetwache (online-strafanzeige.de). © Stocksy United / Marc Tran
Es kommt vor, dass Vorsorge- und Kontovollmachten finanziell missbraucht werden. Wo die Risiken liegen und wie Sie sich am besten vor Missbrauch schützen.
Eine Vorsorgevollmacht und Kontovollmacht ermöglichen vieles. Wer sie in der Hand hat, kann damit für eine andere Person den Alltag regeln: Etwa Gesundheitsentscheidungen treffen, Wohnung- und Pflegeheimfragen klären, Bankgeschäfte erledigen. Aber was passiert, wenn Bevollmächtigte das Vertrauen finanziell ausnutzen, zum Beispiel das Konto leer räumen und das Haus verkaufen?
Es gibt kaum Schutzmechanismen. Ein Notar ist für das Verfassen einer Vollmacht nicht nötig. Unbedingtes Vertrauen ist die Basis dafür, dass Bevollmächtigte alles im Interesse der Vollmachtgeber regeln. Doch Anwalts- und Gerichtspraxis zeigen, dass Vollmachten auch missbraucht werden, vor allem ältere und hilfsbedürftige Menschen sind betroffen. In Anbetracht der demografischen Entwicklung und einer zunehmend älter werdenden Gesellschaft geht die Polizei von einer Zunahme von Missbrauchsfällen aus. „Die Menschen werden nicht nur älter, sie haben auch mehr Vermögen“, sagt Annett Mau vom Landeskriminalamt Berlin.
Ratgeber und Vorsorge-Formulare
Vorsorgevollmacht
Mit einer Vorsorgevollmacht sorgen Vollmachtgeber für den Fall vor, dass sie selbst nicht mehr in der Lage sind etwas zu regeln, etwa nach einem Unfall, krankheits- oder altersbedingt.
Kontovollmacht
Die Kontovollmacht erlaubt es dem Bevollmächtigten, Bankgeschäfte zu erledigen. Sie ist ebenfalls sinnvoll, um für Krankheit oder Unfall vorzusorgen. Unser Test von Kontovollmachten zeigt, was bei welcher Bank möglich ist.
Alle Formulare in einem Set
Handlich und vollständig erhalten Sie alles im Ratgeber Das Vorsorge-Set. Er enthält die wichtigsten Formulare zum Heraustrennen und Abheften. Dazu gibt es Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die in verständlichem Deutsch abgefasst sind.
Rechtsanwälte berichten, vermehrt Fälle von Vollmachtmissbrauch auf dem Tisch zu haben. „Fälle von finanzieller Ausbeutung älterer Menschen nehmen nach unserer Beobachtung zu“, sagt Anwalt Dietmar Kurze, der auch Vorstand im Verein Vorsorgeanwalt ist.
270 000 Euro abgehoben – Erbinnen gehen leer aus
Am Amtsgericht Pfaffenhofen wurde der Fall einer 61-jährigen Nichte verhandelt, die für Konten ihres Onkels Kontovollmachten hatte. Nach seinem Tod hob sie insgesamt 270 000 Euro in bar ab. Das Geld hatte die Frührentnerin bereits vor dem Tod bei mehreren Bankfilialen bestellt, da die Banken Bargeld in dieser Höhe nicht vorrätig hatten. Bei der Auszahlung wussten die Banken nicht, dass der Onkel bereits verstorben war.
Den beiden Töchtern, die Erbinnen sind, fiel das Fehlen des Geldes auf, als sie bei der Bank nachfragten. Vor Gericht argumentierte die Nichte, der Onkel habe ihr das Geld geschenkt beziehungsweise schenken wollen. Das Gericht konnte ihr keinen gewerbsmäßigen Betrug nachweisen und sprach sie frei. „In dubio pro reo“, im Zweifel für die Angeklagte (Az. 2 Ls 41 Js 15317/22).
Bevollmächtigte muss 83 000 Euro zurückzahlen
Eine vom Vater bevollmächtigte Tochter muss rund 83 000 Euro an die Erbengemeinschaft herausgeben, urteilte das Brandenburgische Oberlandesgericht. Die Tochter selbst ist auch Teil der Erbengemeinschaft. Sie hatte eine Kontovollmacht und Zugriff auf die gesamten Konten und Ersparnisse ihres Vaters. Als er noch lebte, überwies sie immer mal wieder Beträge auf ihr eigenes Konto, teils mit dem Verwendungszweck „Sparen“. Beträge von 500 Euro und 250 Euro leitete sie an ihre Söhne weiter.
Nach dem Tod des Vaters verlangte die Erbengemeinschaft einen Nachweis darüber, dass sie das Geld des Vaters bestimmungsgemäß verwendet hatte. Diesen Nachweis konnte sie nicht führen. Die Tochter argumentierte, der Vater habe sie dazu angewiesen, ihren Söhnen die Beträge auszuzahlen. Doch sie konnte keine konkreten Angaben über Zeit und Ort der Anweisungen machen. Ebenso wenig konnte sie nachweisen, dass sie für den Vater Geld für den täglichen Lebensbedarf ausgeben sollte.
Kontovollmacht mit Rechenschaftspflicht
Die Richterinnen und Richter entschieden, dass zwischen Vater und Tochter ein Auftragsverhältnis mit Rechtsbindungswillen bestand ( Paragraf 662 Bürgerliches Gesetzbuch). Es standen erhebliche wirtschaftliche Interessen auf dem Spiel. Die Tochter sollte die Konten nur verwalten und das Geld nach Wünschen des Vaters verwenden. Liegt ein Auftragsverhältnis vor, ist die Bevollmächtigte zur Auskunft und Rechenschaft verpflichtet. Dieser Pflicht konnte die Tochter nicht nachkommen. Das Geld muss sie herausgeben (Az. 3 U 47/23).
Straftaten kommen durch Anzeigen ans Licht
Ans Licht kommen die Taten in der Regel nicht durch eine Anzeige des Geschädigten, wie sonst bei Vermögensstraftaten üblich. Die betroffenen Vollmachtgeber sind ja gerade nicht mehr in der Lage, ihre eigenen Angelegenheiten zu regeln. Sie erkennen den Missbrauch in der Regel nicht. Deshalb sind es oft Erben oder andere Berechtigte, die Anzeige erstatten. Jedoch werden die Vermögensstraftaten durch Bevollmächtigte polizeilich nicht extra erfasst. Eine statistische Erfassung von Betrug, Untreue oder Unterschlagung im Zusammenhang mit Vorsorge- und Kontovollmachten gibt es nicht. Ein Straftatbestand „Finanzieller Missbrauch“ existiert nicht.
Experten fordern mehr Schutzmöglichkeiten
Vor dem Hintergrund vermutlich steigender Missbrauchsfälle fordern Experten mehr Schutzmöglichkeiten für Vollmachten und schlagen zum Beispiel vor:
- Eine einheitliche polizeiliche Erfassung von Vermögensdelikten im Zusammenhang mit Konto- und Vorsorgevollmachten.
- Eine Anlaufstelle für Betroffene, um Verdacht auf Missbrauch zu melden. Ein Hilfetelefon für Verdachtsfälle gibt es zum Beispiel in Österreich und der Schweiz.
- Für die Vorsorgevollmacht zum Beispiel ein obligatorisches Register, in dem auch der Nachweis der Geschäftsfähigkeit bei Erteilen der Vollmacht hinterlegt wird, oder die Verpflichtung, den Eintritt des Vorsorgefalls und einen Widerruf anzuzeigen.
Unbedingtes Vertrauen ist die Basis
In die Gestaltung einer Vorsorgevollmacht mischt sich der Staat bislang kaum ein. Die Vorsorgevollmacht dient dazu, die persönliche Selbstbestimmung zu wahren und eine gerichtliche Betreuung zu vermeiden. Jede und jeder kann frei wählen, wen er oder sie bevollmächtigt. Bei der Wahl von Bevollmächtigten empfiehlt Vorsorgeanwalt Kurze kritisch zu sein: „Wir empfehlen, nur langjährig Vertraute in Betracht zu ziehen.“
Auf Interessenskonflikte achten
Vollmachtgeber sollten darauf achten, dass keine Interessenskonflikte entstehen. Das kann zum Beispiel passieren, wenn es ums Geld geht und Eltern nur einem ihrer Kinder die Kontovollmacht erteilen. Geschwister könnten befürchten, benachteiligt zu werden oder die Sorge haben, dass Bevollmächtigte sich selbst bereichern. Das kann später in einem Rechtsstreit enden. Besser ist es, in solchen Fällen die finanzielle Situation mit allen Beteiligten zu besprechen und klare Regelungen zu treffen. Im Zweifel kann es sinnvoll sein, sich an einen Notar zu wenden, um alles rechtssicher zu formulieren.
Tipp: Was ein Notar kostet und wann ein Notar sinnvoll ist, erklären wir im Special Vorsorgevollmacht.
Betreuungsverfügung kann eine Alternative sein
Wer unsicher ist, für wen er eine Vorsorgevollmacht ausstellen soll oder wer keine Vertrauensperson hat, kann alternativ eine Betreuungsverfügung erstellen und darin Wünsche für eine Betreuung formulieren. Betreuerinnen und Betreuer werden vom Gericht kontrolliert – anders als Bevollmächtigte.
Tipp: Im Ratgeber „Das Vorsorge-Set“ bietet die Stiftung Warentest ein Formular für eine Betreuungsverfügung an und erklärt, was dabei zu beachten ist.
Kontrollbetreuung beim Gericht anregen
Stellt sich bereits zu Lebzeiten des Vollmachtgebers heraus, dass Bevollmächtigte nicht dessen erklärten oder mutmaßlichen Willen beachten, können andere Beteiligte eine Kontrollbetreuung beim Betreuungsgericht anregen. Voraussetzung dafür ist grundsätzlich, dass Vollmachtgeber aufgrund von Krankheit oder Behinderung selbst nicht mehr in der Lage sind, ihre Rechte gegenüber dem Bevollmächtigten geltend zu machen. Nur der Verdacht eines Vollmachtmissbrauchs reicht für eine Kontrollbetreuung aber nicht aus.
Es müssen konkrete Anhaltspunkte und Tatsachen dafür vorliegen, dass dem Betreuungsbedarf des Vollmachtgebers nicht Genüge getan wird. Wer eine Kontrollbetreuung anregen will, wendet sich an das am Wohnort des Vollmachtgebers zuständige Betreuungsgericht, erreichbar über das Amtsgericht.
Wird ein Kontrollbetreuer eingesetzt, überwacht und kontrolliert er spezifische Aufgaben des Bevollmächtigten, wobei die Vorsorgevollmacht gültig bleibt. Kontrollbetreuer sind quasi „Aufpasser“ mit der Befugnis, eine Vorsorgevollmacht zu widerrufen oder Ansprüche gegen den Bevollmächtigten geltend zu machen.
Tipp: Die Stiftung Warentest bietet einen Betreuungsbehördenfinder an. Nach Eingabe der Postleitzahl bekommen Sie die zuständige Betreuungsbehörde angezeigt. Die Behörde hilft bei Fragen rund um eine Betreuung und vermittelt die richtigen Ansprechpartner.
{{data.error}}
| {{col.comment.i}} {{comment.i}} |
|---|
| {{col.comment.i}} {{comment.i}} |
|---|
- {{item.i}}
- {{item.text}}
Streit über 900 000 Euro in bar und Aktien
Vorausschauend hatte eine Mutter im Jahr 2004 ihren beiden Söhnen jeweils eine notarielle Vorsorgevollmacht ausgestellt. 15 Jahre später lebte die an Demenz erkrankte Mutter in einem Pflegeheim. Zuvor, im Jahr 2015, widerrief die Mutter eine der beiden Vorsorgevollmachten, sodass nur noch ein Sohn alleine bevollmächtigt war. Ihm schenkte sie drei Jahre später erhebliche Vermögenswerte: Aktien im Wert von 300 000 Euro und Bargeld in Höhe von 600 000 Euro, insgesamt 900 000 Euro.
Der Bruder ohne Vorsorgevollmacht befürchtete einen Missbrauch und wandte sich an das Betreuungsgericht. Doch bei der Prüfung kam heraus, dass die Mutter dem Sohn das Geld offenbar direkt geschenkt hatte. Eine Kontrollbetreuung lehnte das Gericht ab. Hingegen war der zweite Antrag auf Kontrollbetreuung zwei Jahre später erfolgreich. Der Bruder argumentierte, die Mutter sei zum Zeitpunkt der Schenkungen aufgrund ihrer Demenz geschäftsunfähig gewesen. Die Rechtswirksamkeit der Schenkung müsse überprüft werden. Zum Nachweis reichte der Bruder unter anderem Berichte des sozialpsychiatrischen Dienstes ein.
Bruderstreit landet beim Bundesgerichtshof
Der zweite Antrag auf Kontrollbetreuung landete beim Bundesgerichtshof (BGH). Der Fall war etwas kompliziert, denn der erste Antrag auf Kontrollbetreuung war vom Betreuungsgericht abgelehnt worden. Der BGH entschied jedoch, dass es in Betreuungssachen möglich ist – aufgrund des fürsorgerischen Charakters des Verfahrens – zum Schutz der Betroffenen ein Verfahren neu aufzurollen. Zumal der konkrete Vorwurf der Geschäftsunfähigkeit neu im Fokus stand.
Der BGH entschied, dass im Fall der mittlerweile 90-jährigen Mutter eine Kontrollbetreuung eingerichtet wird. Konkrete Anhaltspunkte sprachen für eine gewisse Wahrscheinlichkeit eines Interessenkonfliktes zwischen den Ansprüchen der Vollmachtgeberin und dem bevollmächtigten Sohn: Die Höhe der Schenkung (900 000 Euro) und der plausible (neue) Einwand, die Mutter sei möglicherweise geschäftsunfähig gewesen. Eine Rechtsanwältin prüft als Kontrollbetreuerin nun, ob die Mutter bei der Schenkung möglicherweise geschäftsunfähig war und ob es einen Rückforderungsanspruch gegen den beschenkten Sohn gibt (Az. XII ZB 178/24).
Pflegerin gehört plötzlich das Haus
Es kommt vor, dass Vollmachtgeber keine engen Vertrauten haben, mit der Familie zerstritten sind oder Angehörige weit entfernt wohnen. Flüchtige Bekannte, Haushaltshilfen oder Pflegekräfte erkennen dann manchmal die Chance, ein Vertrauensverhältnis finanziell auszunutzen. Das kann so weit gehen, dass Betreute zunehmend von ihren bisherigen Bevollmächtigten und der Familie isoliert und dazu gedrängt werden, die ursprüngliche Vorsorgevollmacht zu widerrufen. Der Bekannte oder die Pflegerin erhalten eine neue Vorsorgevollmacht, teils notariell erstellt. Die neuen Bevollmächtigten haben dann Zugriff auf Konto, Vermögen und Immobilien – und nutzen das aus. Im Interview mit der Stiftung Warentest berichtet Kriminalhauptkommissarin Annett Mau vom Landeskriminalamt Berlin, wie hilfsbedürftige Menschen ausgenutzt werden.
Verein setzt sich für Hilfe bei Missbrauch ein
Für mehr Bewusstsein in der Gesellschaft beim Thema Vollmachtmissbrauch setzt sich der gemeinnützige Verein „Initiative gegen Vollmachtmissbrauch e. V.“ (www.vollmachtmissbrauch.de) ein. „Finanzieller Missbrauch ist ein Problem, das insbesondere ältere und schutzbedürftige Menschen betrifft und kaum an die Öffentlichkeit gerät“, sagt Vorständin und Rechtsanwältin Hildegard Winnebeck. Der Verein informiert über Missbrauchsfälle und gibt Hilfestellung.
-

Diese Kontovollmachten bieten Banken und Zinsportale an
- 48 Banken im Test, fast jede hat ihr eigenes Formular für eine Kontovollmacht. Unterschiede im Todesfall und beim Online-Banking haben wichtige praktische Folgen.
-

Mit wenig Aufwand mehr Geld – das geht
- Verträge durchsehen, Alternativen finden, Anbieter wechseln – und einige Hundert Euro im Jahr sparen. Machen Sie unseren Finanzcheck für Alltagsverträge.
-

Das sind die besten Nachwuchs-Tests
- Digital und nachhaltig leben – da liegt bei den 750 Nachwuchs-Tests der Fokus. Sechs überzeugten die Jury der Stiftung Warentest besonders.
Diskutieren Sie mit
Nur registrierte Nutzer können Kommentare verfassen. Bitte melden Sie sich an. Individuelle Fragen richten Sie bitte an den Leserservice.
